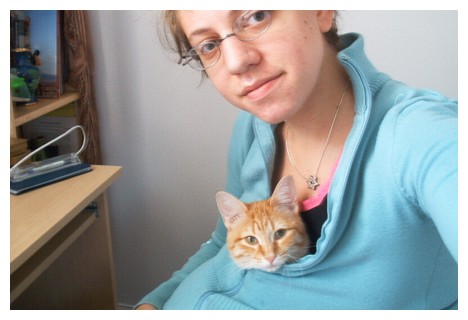Montag, November 21, 2005, 22:14 - PRESSE
Ebenfalls mit regem Interesse gelesen...Walter Däpp im BUND vom 19.11.2005 (Photos aus meinem Bild-Archiv):
Alles muss schnell gehen – auch nach dem Tod: Im Krematorium Bern finden immer weniger Trauerfeiern statt.
Sie ist schnellebig geworden, unsere Zeit – auch dann, wenn man das Zeitliche segnet: Immer weniger Verstorbene werden mit einer Trauerfeier vom irdischen Dasein verabschiedet und ins Grab geleitet. Ein Augenschein im Berner Krematorium – vor dem morgigen Totensonntag. In der Stadt Bern werden 92 Prozent aller Verstorbenen kremiert. Wie emotionslos, prompt und sauber das vor sich geht, war unlängst an einer öffentlichen Kremationsführung mitzuerleben – mit Christian Gasser, dem Geschäftsführer, und André Michel, dem Ofenwart.
«Der Trend bei den Hinterbliebenen zum Verzicht auf eine Trauerfeier ist leider ungebrochen»: Das steht im Jahresbericht der Bernischen Genossenschaft für Feuerbestattung (BGF), die im Krematorium des Bremgartenfriedhofs jährlich gegen 3000 Einäscherungen vornimmt. Und der Trend hält an, wie Geschäftsführer Christian Gasser sagt: «Früher haben wir jährlich an die 1400 Trauerfeiern durchgeführt, Ende dieses Jahres werden es noch etwa 450 sein. Allein 2004 sank die Zahl der Trauerfeiern von 543 auf 505 – noch bevor die neue Abdankungskapelle in Friedhof Bümpliz in Betrieb genommen wurde.» 2004 nahmen auch die meldepflichtigen Einäscherungen um gut drei Prozent ab, von 2801 (2003) auf 2708.

Viele hätten heute auch «Mühe mit kirchlichen Abdankungen», stellt Gasser fest. Und viele begnügten sich mit einer kurzen Andacht bei der Urnenbeisetzung oder engagierten eine freie Trauerrednerin oder einen Trauerredner. Deshalb hätten auch die beiden Organistinnen des Krematoriums «diversifiziert»: Seit einiger Zeit bieten sie ihre Dienste auch als Trauerrednerinnen an – mit Erfolg.
Als Folge der rückläufigen Zahl an Aufbahrungen und Trauerfeiern verkaufte die BGF 2004 auch viel weniger Blumendekorationen: Nur noch 987 statt 1123 ein Jahr zuvor. Und auch die Vermietung von Urnennischen blieb unter den Erwartungen, während «der Zulauf in das Gemeinschaftsgrab weiterhin enorm war», wie im BGF-Jahresbericht steht. Gasser stellt auch einen «Trend hin zur Urnenfeier» fest. Statt den Leichnam in der Kapelle aufzubahren, werde er öfter schon vor der Feier kremiert. Das hat für die Angehörigen den Vorteil, dass sie die Urnenbeisetzung gleich im Anschluss an die Feier durchführen können. Rund zwei Drittel der Feiern im Krematorium Bern sind heute Urnenfeiern, nur noch ein Drittel der Angehörigen nimmt in der Kapelle vom eingesargten Verstorbenen Abschied. «Auch das ist ein Zeichen der Zeit», findet Gasser. Er beobachtet beides: «Einerseits das sehr emotionale Verabschieden eines Verstorbenen, andererseits aber auch den absoluten Trend zum Entsorgen.» Auch in der Gesamtkirchgemeinde Bern stellt man fest, dass sich die Abdankungspraxis gewandelt hat – «hin zu mehr Individualismus, ohne Kirche, ohne Öffentlichkeit, völlig anonym».
Viele Hinterbliebene seien heute auch kostenbewusst, sagt Christian Gasser. Immer öfter erkundige man sich bei der BGF nach dem Preis für eine Kremation («sie kostet 550 Franken, ohne Urne 513 Franken»). Und hie und da komme es auch vor, dass Angehörige sich über das ihrer Ansicht nach unnötige Aufbahren der Toten ärgerten, doch: «Zwischen Todeszeit und Einäscherung gilt eine Sperrzeit von 48 Stunden – da muss man die Toten irgendwo aufbahren.»

Nicht jeder Geschäftsbereich der BGF ist aber rückläufig, wie Gasser sagt. So würden im Krematorium immer mehr «Nachgeburten und nicht infektiöse Amputate» verbrannt, die von Spitälern «in chlorfreien Plastikkübeln» angeliefert würden und «als Füllauftrag» willkommen seien. «Es sind über zehn Tonnen pro Jahr», sagt er, «abgerechnet wird per Kilo.» Im Jahresbericht ist das so vermerkt: «Im Segment Amputate-Einäscherung stieg die Verarbeitungsmenge immerhin von 9,3 Tonnen auf 10,3 Tonnen oder um 11 Prozent.»
Übrigens: Im Krematorium würden «keine strahlenverseuchten oder hochinfektiösen Leichen» verbrannt. Und «aus Umweltschutzgründen» werde demnächst die Rauchgasreinigung saniert.
«Der Ofenwart zeigt, wie die Einfahrt geht»
Emotionen haben da keinen Platz. Ofenwart André Michel öffnet den Sargdeckel am Fussende der Leiche um Handbreite und schiebt ein Tontäfelchen mit der Kremationsnummer hinein – zwecks späterer korrekter Zuordnung der Asche. Dann lässt er den Sarg per Knopfdruck «einfahren»: Das Ofentor öffnet sich, der Sarg gleitet wie auf Schienen in die glühend heisse Öffnung. Und bevor es sich wieder schliesst, das Tor, bringt ein Ventilator die Flammen zum Züngeln.
Der «Haupteinäscherungsprozess» dauert, bei rund 800 Grad, eine bis eineinhalb Stunden, manchmal auch länger – dann zum Beispiel, erklärt Christian Gasser, «wenn der Sarg aus Massivholz oder der Leichnam überdurchschnittlich massig» sei, oder wenn gewisse zu Lebzeiten eingenommene Medikamente die Brennbarkeit der Leiche beeinträchtigten. Zugelassen sind Särge aus Fichte, Tanne und Pappelholz, sagt Gasser – wenn nicht «ein in Massivholz angelieferter Leichnam aus Gran Canaria oder so» eine Ausnahme rechtfertige.
Christian Gasser, 57-jährig, ehemaliger Bankangestellter, ist seit neun Jahren Geschäftsleiter der Bernischen Genossenschaft für Feuerbestattung (BGF). Und den Vorgang des Kremierens von Leichen erläutert er jetzt auch so, wie er früher wohl Zahlen analysiert hat: nüchtern, schnörkellos – so, als kommentierte er den Geschäftsgang eines ganz gewöhnlichen Unternehmens. Die Kunden dieses Unternehmens sind nicht die Verstorbenen oder ihre Angehörigen, sondern vierzig Bestatter. Sie haben rund um die Uhr Zugang zu den 33 Aufbahrungskabinen und zum Kühlraum «für Särge, die bereits riechen», wie Gasser sagt. Im Moment sind nur neun Kabinen belegt, doch manchmal, etwa während Festtagen, sei hier Hochbetrieb: «Da müesse mer aube luege, dass mer düre möge.» Denn hier gebe es «keine industrielle Verarbeitung», betont Gasser: «Bei uns wird tagfertig gearbeitet.»
.....................
 .............................
.............................Die übliche Aufbahrungszeit beträgt drei Tage – «das sollte ausreichen, um die Formalitäten zu erledigen und Todesanzeigen aufzugeben». In den Aufbahrungskabinen ist es kühl – zwischen 11 und 14 Grad. Und das Trennglas zwischen den Besucherzonen und den aufgebahrten Verstorbenen ist nicht so unverrückbar, wie es scheint. «Angehörige, die zum Sarg möchten», verspricht Gasser, «können sich bei uns im Büro melden.»
Beim Aufbahren der Toten stellt Gasser fest, dass man «immer mehr vom Leichenhemd wegkommt». Die Toten würden meist in Strassenkleidern bestattet – «in Kleidern, die ihnen zu Lebzeiten lieb gewesen sind». Nur Schuhe würden nicht toleriert – dies gäbe «beim Einäschern Probleme mit dem Umweltschutz». Herzschrittmacher seien vom Arzt zu entfernen, weil sonst «giftige Dämpfe durchs Kamin entweichen». Und auch «punkto Sargzugaben» sei nicht alles erlaubt: «Teuren Schmuck vernichten wir nicht. Haustiere kremieren wir nicht. Auch dem Wunsch, einen Toten samt Bassgeige einzuäschern, haben wir nicht entsprochen. Und als man einem Verstorbenen eine Flasche Wein mitgeben wollte, lehnten wir ebenfalls ab: Geschmolzenes Glas setzt sich im Ofen fest.»
Die oft nach Kremationen zurückgebliebenen künstlichen Hüftgelenke würden übrigens umweltgerecht rezykliert: Das hochwertige Material werde gesammelt, nach Holland geliefert, dort sortiert «und dann in Schweden unter anderem zu Schiffschrauben verarbeitet», berichtet Gasser.
Er führt nun ins Ofenhaus – ins «Herzstück des Krematoriums». Und sagt: «Herr Michel, unser Ofenwart, zeigt nun, wie die Einfahrt geht.» Er, André Michel, 57-jährig, einst Bauspengler, Seefahrer, Lüftungsmonteur und Speditionsangestellter, ist seit neun Jahren im Krematorium tätig und tut dies beeindruckend natürlich und emotionslos. «Anders», sagt er, «ginge es nicht. Sonst könnte ich nach Feierabend nicht abschalten, ginge kaputt. Ich sage mir immer wieder, dass ein Leichnam kein Lebewesen mehr ist, nur noch etwas Totes – etwas, von dem die Seele schon gegangen ist.» Alle müssten einmal «diesen Weg gehen». Doch inzwischen glaube auch er, «dass es «nach dem Tod nicht fertig ist, sondern irgendwie weitergeht».
«Eingefahren» werde «immer Kopf voran», sagt Ofenwart Michel. Und gesteuert werde «der Einäscherungsprozess von diesem Pult aus». Über einen Spiegel prüfe er stets die Kamine: «Wenn es raucht, blinkt auf dem Schaltpult eine Alarmlampe auf.» Nach dem Haupteinäscherungsprozess werde die Asche zur Nachverbrennung in den Ofen im Untergeschoss gestossen – «mit däm Stünggu abeputzt», wie Michel zeigt. Doch sonst sei die Kremation «ein geschlossener Prozess», der nur durch kleine Gucklöcher kontrolliert werde. Meistens befänden sich «zwei Körper im Ofen – einer in der Haupteinäscherung, einer in der Nachverbrennung». Und: Wenn ein Sarg einmal drin sei, sei er drin, dann sei der Prozess «nicht mehr zu stoppen».

Zum Zerkleinern und Mahlen der ausgeglühten und abgekühlten Asche zieht sich Michel Hut und Staubmaske an. Und bevor er die – noch mit vielen groben Rückständen durchsetzte – Asche in die Mühle schüttet, sucht er nach zurückgebliebenen Hüftgelenken und dergleichen. Die Sargnägel und weitere metallene Gegenstände zieht er mit einem Magneten heraus. Nach dem Mahlen füllt er die feine Asche in eine der bereitgestellten Urnen – samt Keramikplättchen mit der Kremationsnummer des Toten. Es gibt Tonurnen, Kupferurnen, Holzurnen und Biournen. Michel kennzeichnet sie mit einem Urnenzeugnis, «einer Art Lieferschein». 98 Prozent der Urnen würden später von den Bestattern abgeholt, zwei Prozent von den Angehörigen. Und einige verschicke man per Post.
Michel erläutert die Vor- und Nachteile der einzelnen Urnen und betont, dass die Asche nur in Urnen abgegeben werde – «also nicht in Plastiksäcken oder so». Die Asche sei «in der Regel grau», hie und da aber auch rötlich, bläulich oder grünlich – «wohl als Folge gewisser Medikamente, die der Tote einst eingenommen hat». Die Frage etwa, ob nicht Kartonsärge besonders kostengünstig und praktisch seien, verneint er: «Nein. Sie fackeln ab wie Zunder. Deshalb ist eine Sonderkremation nötig, mit Holzpalett.» Und auf die Energiefrage angesprochen sagt er, man sei bestrebt, die drei Öfen nie ganz abkalten zu lassen. Gut sei es, wenn sie bei Arbeitsbeginn am Morgen jeweils «noch um die 600 Grad» abgäben – da könne man sogleich wieder «einfahren».
Nach der Führung meint eine der Teilnehmerinnen, eine Krankenschwester, sie sei «beeindruckt von diesen Männern»: Es sei in Ordnung, dass diese schwierige Arbeit für sie keine emotionale Sache, sondern «ein technischer Ablauf» sei. Auf eine andere Besucherin hat «alles völlig selbstverständlich und natürlich gewirkt»: Die Angestellten im Krematorium hätten «ja wirklich nur noch mit dem Körper der Verstorbenen zu tun – nicht mehr mit den Menschen».
Geschäftsführer Christian Gasser nickt. Nach der Führung trinkt er in der Krematorium-Kantine einen Espresso, raucht eine Zigarre, «Orient Express, Grand Luxe Churchill» – und meint: «Unser Geschäft ist ein Geschäft wie jedes andere – fast wie jedes andere. Wir müssen aber emotionslos an die Sache herangehen, Abstand halten. Sonst geht es nicht.»
.................
 ................
................Montag, November 21, 2005, 21:54 - PRESSE
Sehr lesenswerter Wochenend-Leitartikel von R. M. in der NZZ Nr. 271 vom 19./20.11.2005: Schrumpfende und wachsende Gesellschaften
Alarmierende Töne vernimmt man aus den beiden Lagern in der Debatte über die demographische Entwicklung auf unserem Planeten Erde. Auf der einen Seite gibt es die zum Teil dramatischen Warnungen vor schrumpfenden Gesellschaften und den materiellen oder sozialen Folgen dieser Entwicklung. Solche Stimmen sind vor allem in Europa und in Japan zu hören. Hier sind die Geburtenraten in den letzten zwei Jahrzehnten insgesamt rückläufig. Sie liegen deutlich unter 2,1 Kindern pro Frau - der für die numerische Erhaltung einer Gesellschaft notwendigen statistischen Quote. William P. Butz, Vorsitzender eines auf demographische Fragen spezialisierten Instituts in Washington, bezeichnet die Vertreter dieser einseitig auf schrumpfende Bevölkerungen fixierten Denkrichtung als Implosionisten.
Auf der andern Seite stehen die sogenannten Explosionisten. Diese konzentrieren ihre Sicht und Sorge allein auf die Tatsache, dass die Weltbevölkerung weiterhin rasch anwächst. Nach einer häufig zitierten Uno- Schätzung wird die Zahl von heute 6,5 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050 nochmals um fast 50 Prozent auf 9 Milliarden zunehmen, ehe ein global rückläufiger Trend einsetzen könnte.
Die Explosionisten argumentieren, dass über 90 Prozent dieses Bevölkerungswachstums auf Entwicklungsländer im südlichen Teil der Erde entfallen würden, was in diesen Ländern zusätzliche soziale Konflikte anfachen und gleichzeitig den Druck zur Migration in die wohlhabenderen Regionen der nördlichen Halbkugel steigern werde. In dieser Perspektive muss ein weiteres Anwachsen der Weltbevölkerung während der nächsten Jahrzehnte nahezu unausweichlich zu verschärften Umweltkrisen und möglicherweise neuen Kriegen um knapper werdende Naturressourcen führen.
Anders als die meisten Länder Europas, inklusive Russland, und anders als Japan oder China (mit seinen staatlich verordneten Einkindfamilien) gehört Amerika zu jenen Industrienationen, wo weder eine schrumpfende Bevölkerung und eine gesellschaftliche Überalterung drohen noch sich die Gefahr einer sozial und materiell schwer zu verkraftenden Überbevölkerung (wie in Indien oder Pakistan) abzeichnet. In den USA liegt die Geburtenrate mit durchschnittlich 2 Kindern pro Frau praktisch auf dem Niveau des Reproduktionsfaktors. Hinzu kommen jährlich fast eine Million legale Immigranten (die Zahl der illegalen Einwanderer bleibt im Dunkeln). Wenn dieser Trend anhält, wird die Bevölkerung Amerikas von heute 290 Millionen bis zum Jahr 2050 auf 420 Millionen anwachsen.
Im gleichen Zeitraum wird nach heutigen Prognosen die Bevölkerung Deutschlands (mit 1,3 Kindern pro Frau) selbst bei gleich bleibender Einwanderung von 80 auf 70 Millionen schrumpfen. In Italien, Spanien, aber auch in Japan und Südkorea liegen die Fertilitätsraten noch niedriger. In Russland verkleinert sich die Bevölkerung schon seit Jahren empfindlich, weil dort neben einer tiefen Geburtenzahl die durchschnittliche Lebenserwartung wesentlich geringer ist als in Westeuropa. Indessen sind die demographischen Entwicklungen auch in Europa durchaus nicht einheitlich. In Irland und Island, in Frankreich und einigen skandinavischen Ländern wird die Bevölkerungszahl allein durch die Geburtenrate einigermassen im Gleichgewicht gehalten.
Die Gründe für die höhere Gebärfreudigkeit in einigen hochentwickelten westlichen Ländern sind offenbar nicht allein in staatlichen Unterstützungsmassnahmen (Kindergeld, Mutterschaftsurlaub, Ganztagesschulen) zu suchen. In den USA sind solche materiellen Vergünstigungen wesentlich bescheidener als etwa in Frankreich. Mehr Nachwuchs dürfte in unseren Breitengraden auch mit einem optimistischeren oder vertrauensvolleren gesellschaftlichen Klima, das kaum nur durch materielle Faktoren bestimmt wird, zu tun haben.
Die Perspektive abnehmender Bevölkerungen muss nicht notwendigerweise zu pessimistischen Niedergangsszenarien führen. Es gibt Prognostiker, die solche Entwicklungen für erstrebenswert halten, weil dadurch die Natur eher geschont und möglicherweise die allgemeine Lebensqualität erhöht werde. Probleme der materiellen Wohlstandssicherung wie die Frage der Altersrenten, so diese These, könnten auch bei sinkenden Geburtenraten gelöst werden - nämlich einerseits durch eine Erhöhung der wirtschaftlichen Produktivität und andererseits durch die Heraufsetzung des Pensionsalters.
Das mag bis zu einem gewissen Grade einleuchten. Doch wer übernimmt dann bei geringem Nachwuchs die soziale Betreuung der zunehmenden Zahl von nicht mehr arbeitsfähigen und pflegebedürftigen Alten? Die zentrale Herausforderung einer schrumpfenden Wohlstandsgesellschaft ist ja nicht die gesamthaft abnehmende Bevölkerungszahl, sondern die Überalterung, das heisst der wachsende Anteil der über 80-Jährigen bei gleichzeitig sinkenden Quoten für jüngere und mittlere Jahrgänge. Dass solche Verschiebungen in der Alterspyramide unweigerlich auch die Mentalität und innere Dynamik einer Gesellschaft beeinflussen, liegt auf der Hand - auch wenn man darüber kontrovers philosophieren kann, ob das mehr Nachteile oder Vorteile mit sich bringt.
Durch Einwanderung lassen sich die Probleme von Gesellschaften, deren Geburtenrate kontinuierlich unter der für die Reproduktion notwendigen Quote liegt, zumindest temporär entschärfen. Viele wohlhabende Länder profitierten bisher von einer dosierten Immigration - insbesondere die USA, deren Aufstieg zur wirtschaftlich und militärisch führenden Weltmacht ohne den stetigen und mindestens teilweise gezielt gesteuerten Zustrom neuer Kräfte und Talente kaum vorstellbar wäre.
Nachhaltig kann ein Bevölkerungsrückgang indessen nicht durch unbegrenzte Zuwanderung kompensiert werden. Denn erfahrungsgemäss haben Immigranten auf längere Sicht auch nicht mehr Kinder als in der neuen Heimat üblich. Und dass eine massenhafte Integration von Immigranten aus ferneren Kulturkreisen alles andere als problemlos verläuft, haben die jüngsten Banlieue-Unruhen in Frankreich oder die Terroranschläge in London im vergangenen Sommer wieder ins Bewusstsein gerufen.
In der Debatte um die demographische Zukunft reden die um schrumpfende Gesellschaften besorgten Implosionisten und die wegen der noch auf Jahrzehnte hinaus zunehmenden Weltbevölkerung alarmierten Explosionisten weitgehend aneinander vorbei. Beide Seiten führen aus ihrer Perspektive gewichtige Argumente ins Feld. Dass Frauen im afrikanischen Armenhaus Niger im Durchschnitt immer noch 8 Kinder zur Welt bringen (müssen) und die gegenwärtige Weltbevölkerung bis zur Mitte dieses Jahrhunderts nochmals um 50 Prozent ansteigen soll, ist kaum ein erstrebenswerter Zustand. Und es besteht auch kein Grund, sich beruhigt zurückzulehnen, weil in einigen reichen Ländern Westeuropas, in Japan und in Osteuropa die Geburtenzahlen sich seit Jahren weit unter der Reproduktionsrate bewegen.
Demographische Entwicklungen können in offenen Gesellschaften Gott sei Dank nicht diktatorisch dekretiert werden, wie das in China geschehen ist. Aber sie können durch materielle Massnahmen und breite gesellschaftspolitische Diskussionen beeinflusst werden. Ideal wären weder dramatisch wachsende noch bedrohlich schrumpfende Gesellschaften.
Montag, November 21, 2005, 18:01 - GEDACHTES
An den sogenannten "weiblichen Reizen" bzw."Waffen".Kennen Sie ja sicher auch: Die Jungs und Männer, die da anfänglich gleich reihenweise herumstanden.
So rein "zufälligerweise" meist haargenau hinter den Schülerinnen, Lehrtöchtern, Studentinnen, Praktikantinnen etc, die während der warmen Jahreszeiten am Mittag in Scharen irgendwo in der Stadt herumsassen und sich schnell verpflegten.
Und dabei, bewusst oder unbewusst, tief blicken liessen.

Ist Ihnen auch aufgefallen, dass die männlichen Reihen sich schon bald lichteten? Sich mit der Zeit sogar mehr oder weniger vollständig auflösten?
Ich glaube, auch MANN kann davon langsam aber sicher mal genug bekommen.
Strings, Arschspalten, Unterwäsche, nackte Haut in allen Variationen und rund um die Uhr, in den Badeanstalten noch das zusätzliche Unterhaltungsprogramm der verbreitet nicht mehr vorhandenen Oberteile – da gewöhnt man sich einfach dran.
Das ist bald einmal nicht mehr interessant.
Das wird dann sogar auch einfach ziemlich
langweilig...
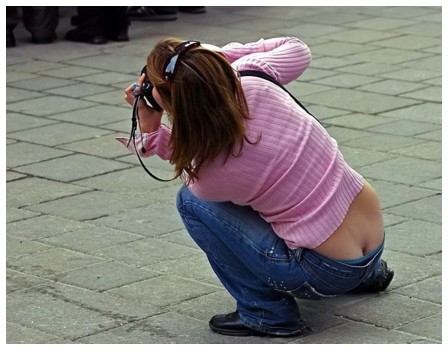
Einerseits natürlich nicht schlecht: Keine anzüglichen und lästigen Voyeurblicke mehr; endlich die Freiheit in der Wahl der Kleidungsstücke - ohne immer gleich denken zu müssen, ob das Teil nicht doch vielleicht zu aufreizend sein könnte…
Andererseits: Die armen Mädels, die sich bisher vor allem auf die Wirkung ihrer weiblichen Reize verliessen – jetzt, wo diese langsam ihre todsichere Wirkung einbüssen, müssen auch sie zeigen, was sie denn sonst noch so drauf haben...
Also, ich finde das gar nicht mal so schlecht, diese Entwicklung.
(beide Photos übrigens: aus dem Netz gefischt...)
Sonntag, November 20, 2005, 22:31 - GEDACHTES
Ich bin bisher immer wieder auf ungläubiges Staunen, auf Ablehnung, auf totales Unverständnis gestossen, wenn ich – selber verzweifelt ob den Scheusslichkeiten und der Not, die sie mit sich bringen - die These vertrat, dass Gewalt, Hass, Kriege, Naturkatastrophen etc. offenbar - und leider, und absolut gegen meine innerste Überzeugung - notwendig zu sein scheinen für die Menschen, um von Zeit zu Zeit wieder zur Besinnung zu kommen.Ich bin nicht mehr allein.
Régis Debray brachte es vor etwa einem Jahr auf den Punkt mit seiner aberwitzigen Formulierung: „Ein Mittel zur Erlangung einer neuen nationalen Identität könnte ein Krieg sein.“
Er brach ein Tabu, und man war schockiert, dass ein so kluger Mensch etwas so Dummes sagen konnte.
Ja - man muss tatsächlich wieder ernsthafter darüber nachdenken.
Paris - der Wahnsinn im Nahen Osten, im Irak - der noch grössere Wahnsinn in Afrika, über den die Medien kaum berichten – die Fussballspiele der Schweizer gegen die Türkei; Fussball sowieso – die Liste ist unendlich.
Der deutsche Zeithistoriker Joachim C. Fest kürzlich in einem NZZ-Interview: „Wir müssen das Böse in unsere Rechnung vom Menschen wieder stärker aufnehmen, als es seit der Aufklärung geschehen ist.“
Sonntag, November 20, 2005, 22:09 - PRESSE
Wenn eine moralische Instanz in Deutschland über alle Zweifel erhaben ist, dann der TÜV. Wer kauft schon ein Kinderfahrrad oder einen Staubsauger ohne dessen Siegel? Jetzt im November, wenn die Tage kürzer werden, helfen uns die Ingenieure wieder aus der Patsche. „Schokolade hilft bei schlechter Laune“, lässt uns der TÜV Süd wissen. Über 800 Inhaltsstoffe habe die Schokolade, darunter Tryptophan, und: Je mehr von diesem Stoff das Gehirn erreicht, umso besser die Stimmung.Also, ihr „Du bist Deutschland“-Werber, verteilt Schokolade, dann kommt der Ruck. Oder? Schon heute isst jeder Bundesbürger im Schnitt mehr als 60 Tafeln Schokolade jährlich – im Zweifelsfall sind das ebenjene sechs Kilo Übergewicht, die uns die gute Laune im Frühjahr wieder verderben. „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“, sang Trude Herr. Aber damit wäre jede Kampagne überfordert.
(Dietmar H. Lamparter, DIE ZEIT 45/03.11.2005)
Sonntag, November 20, 2005, 22:04 - GEDACHTES
Die Brunnen geleert, den Wasserhahn zugedreht...
... die letzten Rosen standhaft im Kampf gegen die Vergänglichkeit...

... die Sommerterrassen geräumt...

... das Laub gefallen...

... und die letzten Äpfel - kurz vor dem ersten Frost - bekömmlich wie nie zuvor.

Sonntag, November 20, 2005, 21:28 - PRESSE
"Don't ask me nothin' about nothin' - I just might tell you the truth." (Bob Dylan)Bislang gehörte es zum Setting, dass er schwieg, wenngleich auf die beredteste Art und Weise. Virtuos seine Taktiken, keine Interviews zu geben. Legendär seine ans Nullsilbige grenzende Lakonie auf Konzerten. Ließ er sich doch einmal zu einem Kommentar hinreißen wie damals in der Free Trade Hall zu Manchester, als die Judas-Rufe im Publikum so laut wurden, dass kurzfristiges Zurückbelfern nicht zu vermeiden war, überließ er die abschließende Antwort immer noch der Band, die bereits hinter ihm mit den elektrischen Gitarren im Anschlag wartete. Auslöschung von Rede durch Sound, die überlieferte Anweisung: »Play it fucking loud!«
Sollte dereinst einmal Bob Dylans gesammeltes Schweigen erscheinen, es füllte Bände. Eine Bibliothek nicht gesprochener Worte, übertroffen nur von den gesammelten Fußnoten seiner Jünger, herausgefordert vom Schweigen des Meisters. Vielleicht wird Dylan, der nichts mehr hasst als die Schubladen, in die man ihn stecken wollte, nach seinem Tod einmal nicht als Sänger, sondern als Psychoanalytiker seiner Generation in die Geschichte eingehen. Schließlich hat er Fantasien aller Art auf sich gezogen, um sie zugleich an den Absender zurückzuweisen, und so einen unendlichen Strom der Rede provoziert. Sicher ist, dass dieses Gleichgewicht des Schreckens vier Jahrzehnte andauerte. Umso überraschender, dass er sich nun zu einem sensationellen Schritt entschlossen hat: Er spricht.
Kein Witz. In Martin Scorseses dreieinhalbstündiger Dokumentation No Direction Home spricht Dylan über Dylan. Und zwar nicht, wie in den vergangenes Jahr erschienenen Chronicles, in dürren Buchstaben, nein, er hält seinen alt gewordenen Dickschädel frontal in die Kamera, sodass man darin lesen kann wie in einem Buch. Eine Autobiografie der Linien und Falten unter beachtlichen Tränensäcken, gekrönt von der berühmten Pudelfrisur, die mehr denn je wirkt wie eine falsch herum aufgesetzte Perücke. Als wäre das nicht schon schockierend genug, scheint er auch noch zu lächeln. Deutlich genug jedenfalls, um einen ebenso eindeutigen wie unerhörten Befund zu rechtfertigen: Dylan kann selbstironisch sein. In all den Jahren hat der alte D. eine gewisse Distanz zu der Figur entwickelt, die er in den frühen Sechzigern einmal war. (...)
Dies und noch mehr ist nachzulesen im lesenswert-schönen Artikel von
Thomas Gross in der ZEIT 43/20.10.2005:
Sonntag, November 20, 2005, 21:23 - GEDACHTES
Da war gestern Freitag noch Normalbetrieb. In der Nacht auf Samstag wurde offenbar auf radikalen Weihnachtsbetrieb umgestellt.
Überall und ausnahmslos.
Nur Sterne, Glimmer, Glitzer, Engel, Lametta, Fassaden-Nikoläuse und Adventskalender gesehen heute.
Ich würd’ dann vorschlagen:
Feiern wir Weihnachten doch an diesem Sonntag – das gibt dann einen ruhigen Novemberrest, einen sehr ruhigen Dezember… und die Geschäfte könnten ab übermorgen Montag z.B. die Frühlingsmode präsentieren...
Wär doch was.
<<nav_first <Zurück | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | Weiter> nav_last>>